Der Nettoretourenwert
Der Nettoretourenwert
Der Nettoretourenwert* ist eine rechnerische Größe, die aus Sicht des Retourenempfängers Aufschluss über die wirtschaftlichen Auswirkungen einer Retoure gibt.
Basis ist der erwartete Wiederverkaufswert einer B- oder C-Retoure, d.h. dem Betrag, der mit der Ware oder ihren veräußerten oder zurückgewonnenen Bestandteilen am Markt erzielt wird.
* Retourenmanagement im Versandhandel, Asdecker, 2014
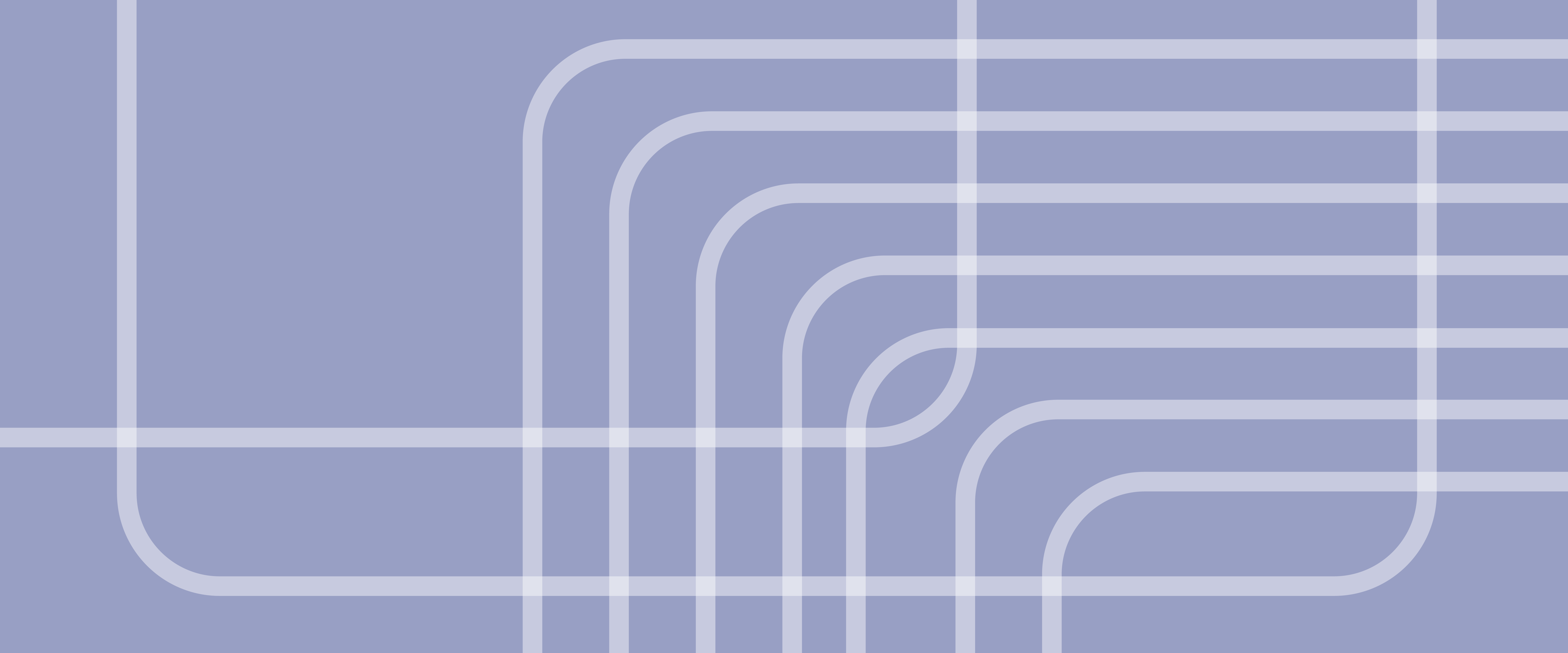
Akquisitionskosten
Akquisitionskosten sind die Kosten, die durch die Rücknahme der retournierten Ware entstehen. Dazu gehören im Online-Handel vor allem das Rückporto sowie Opportunitätskosten. Letztere entsprechen dem erstatteten Kaufpreis bzw. der Forderungsabschreibung beim Rechnungskauf.
Cons
- Die Akquisitionskosten werden rechnerisch von dem erwarteten Wiederverkaufswert subtrahiert.
- Aufgrund der Opportunitätskosten fällt der Nettoretourenwert in vielen Fällen negativ aus.
Bearbeitungskosten
Die Bearbeitungskosten umfassen alle im innerbetrieblichen Prozess der Retourenbearbeitung anfallenden Aufwände. Dabei handelt es sich vorwiegend um Personalkosten.
-
Pros
- Die Bearbeitungskosten können durch effiziente Prozesse in der Retourenbearbeitung, der Logistik und im Kundenservice minimiert werden.
-
Cons
- Bearbeitungskosten schmälern den Nettoretourenwert.
Kundenbeteiligung
Als Kundenbeteiligung bezeichnet man Zahlungen vom Kunden an den Versender bzw. Retourenempfänger für die Bearbeitung der Retoure. Dabei kann es sich um Rücksendegebühren handeln oder der Kunde wird durch einen Wert- bzw. Schadensersatz in die Pflicht genommen. Auch können Kunden für die Wartung oder Instandhaltung von Produkten zur Kasse gebeten werden.
-
Pros
- Der vom Kunden beigesteuerte Betrag wird auf den Nettoretourenwert aufaddiert.
- Zahlungen seitens des Kunden reduzieren die im Zusammenhang mit einer Retoure anfallenden Kosten und tragen zu einem positiven Nettoretourenwert bei.
-
Cons
- Kundenbeteiligungen machen nur einen kleinen Teil der Retourenpraxis aus
Kundenwertzunahme
Ausgehend von der Prämisse, dass positive Erfahrungen der Kunden mit dem Retourenmanagement die Kundenzufriedenheit erhöhen, nimmt man eine Erhöhung des Kundenwertes („Customer Value“) nach einer erfolgreich durchgeführten Retoure an. Dies entspricht der Summe der auf die Gegenwart abgezinsten künftigen Deckungsbeiträge.
-
Pros
- Der Kundenwert stellt bei der Ermittlung des Nettoretourenwerts den einzigen nicht objektiven Wert dar.
- Im Rahmen einer Neukundengewinnungsstrategie können Händler die Rückgabemöglichkeit bewusst als Anreiz (Förderung) einsetzen. In diesem Fall kann die Kundenzunahme die Akquisitions- und Bearbeitungskosten übersteigen.
-
Cons
-
Der Kundenwertzunahme-Faktor ist im Rahmen der Nettoretourenwert-Ermittlung am schwierigsten zu quantifizieren.
-
Weiterlesen … Der Nettoretourenwert
- Aufrufe: 47